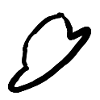»Als es zu regnen begann, machte sie sich auf den Weg«, sagte die KI.
Ich schaute aus dem breiten Panoramafenster des Wohnzimmers auf die Dürre, die sich vor mir erstreckte. Die kleinen Sträucher erinnerten mich an ihre Haare, die ihr büschelweise ausgefallen waren.
Ich schüttelte den Kopf, um die Wehmut zu verdrängen. »Was meinst du mit regnen?«, fragte ich in den Raum und die KI des Hauses zögerte.
»Es hatte angefangen zu regnen und sie wollte hinausgehen. Ihr Zustand ließ ein paar Minuten frische Luft zu, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass sich die Außentemperatur immer noch bei 27 Grad Celsius befand. Also habe ich es gestattet.«
»Und Dir ist nicht in den Sinn gekommen, dass die Frau halluziniert?«
Es hatte seit Jahren nicht mehr geregnet und das Haus musste das wissen. Wie konnte es sie einfach gehen lassen?
»Es hat geregnet«, antwortete das Haus und vielleicht bildete ich mir das nur ein, aber es klang schnippisch.
»Das ist unmöglich!«, rief ich und ging zum Touchscreenpanel neben der Eingangstür. Ich wählte die Videoüberwachung der letzten Stunde. Verdammt, Anastasia war da bereits verschwunden. Ich spulte weiter zurück und da fand ich sie endlich. Drei Stunden war sie schon unterwegs, drei Stunden in der trockenen Wüste!
Ich schluckte einen Kloß im Hals herunter, spulte weiter zurück und da sah ich den Regen.
Ich schluckte, während Anastasia auf der Aufnahme vor dem Panoramafenster stand, hinter dem dicke Wolken den Himmel verdunkelten. Sie starrte auf die Regentropfen auf dem Glas. Der Untertitel: Patientin #78, Anastasia Makitzsch.
Regen! Aber ich hatte nichts mitbekommen. Wie hatte ich den ersten Regen seit acht Jahren verpassen können?
»Ist die Aufnahme in irgendeiner Form verfälscht?«, fragte ich. Die KI schwieg. Auch eine Antwort, dachte ich und ärgerte mich, dass ich ihr für einen Augenblick geglaubt hatte.
Auf dem Weg zum Auto dachte ich über die KI nach. Für jeden Bewohner wurde der persönliche Assistent speziell eingerichtet. Anastasias klang wie Bernhard, ihr verstorbener Mann, ein Seemann, der vor zwanzig Jahren verunglückt war. Bernhard war ihr Ein und Alles, hatte sie mir einmal berichtet, und wenn sie sterben würde, wünschte sie sich eine Seebestattung, um endlich wieder mit ihm vereint sein zu können. Das Wasser würde ihre Seelen verbinden, glaubte sie. Die Empathiemodule der KIs waren das Neuste vom Neuen und nur mit deren Hilfe war es uns überhaupt möglich, uns zu fünft um achtzig sterbende Menschen zu kümmern. Doch das war das erste Mal, dass eine KI log. Sich dermaßen für eine Patientin einsetzte, dass sie uns hinters Licht führte oder war das schon öfter passiert?
Wenn wir uns auf die KIs nicht mehr verlassen können, haben wir ein Problem, dachte ich, während ich die Fahrertür öffnete.
»Hallo, wo soll es denn hingehen?«, fragte mich die KI des Autos und ich seufzte.
»Patientin #78 ist aus dem Gebäude geflüchtet. Orte sie und folge ihr!«, befahl ich dem Fahrzeug.
»In Ordnung. Soll ich währenddessen Musik spielen? Wie wäre es mit …«
»Nein!«, unterbrach ich barsch, doch die KI ließ sich nicht beirren.
»Na gut. Ich habe Patientin #78 geortet. Sie befindet sich acht Kilometer westlich von hier. Ich fahr mal los.«
Acht Kilometer! Anastasia hatte Lungenkrebs im Endstadium, konnte nicht einmal die Treppen laufen und sollte es jetzt acht Kilometer durch die heiße, trockene Wüste geschafft haben?
»Bewegt sie sich noch?«, fragte ich das Auto.
»Ja, sie ist noch unterwegs, aber ich bin schneller«, jetzt klang das Auto irgendwie stolz. Bildete ich mir das nur ein?
Ich schaute auf die Rückbank, auf der ein Notfallkoffer lag. Umständlich kramte ich ihn hervor, legte ihn auf den Beifahrersitz, während mir das Auto stetig die kleiner werdende Distanz berichtete. Ich überprüfte den Inhalt, doch die Medikamente oder Decken waren mir egal, erst als ich die Wasserflasche in der Hand hielt, atmete ich erleichtert auf.
»Gleich können Sie Patientin #78 sehen«, berichtete das Auto.
Ich schaute nach vorn. Die Luft waberte über dem heißen Boden und ich war dankbar für die Klimaanlage, die mir kühle Luft ins Gesicht blies. Da! Ein Schatten am Horizont, der stetig wuchs. Und dann endlich konnte ich den gekrümmten Körper genau erkennen.
»Halt!«, befahl ich dem Auto und es bremste, etwas zu abrupt für meinen Geschmack. Ich schnappte mir die Wasserflasche, stieg aus und ging die letzten Meter zu Fuß. Ich wollte sie nicht mit einem heranrasenden Auto erschrecken.
»Anastasia«, rief ich ihr zu, »was machst Du denn?«
Die Frau blieb stehen, wandte sich mir zu und ihr Lächeln beruhigte mich für einen Augenblick.
»Es regnet«, sagte sie und zeigte nach oben.
Ich schaute in den strahlend blauen Himmel. »Hier ist keine Wolke«, sagte ich.
»Es regnet«, wiederholte sie und dann lachte sie. Ein fröhliches, unbeschwertes Lachen, wie das eines Kindes.
Ich ging auf sie zu, öffnete die Wasserflasche, doch als ich vor ihr stand, in ihre strahlenden grünen Augen sah, bemerkte ich, dass sie ganz nass war. Ich blickte auf sie herab. Ihr Nachthemd war fast durchsichtig, klebte an ihrem Körper. Wie konnte die Frau bei dem Flüssigkeitsverlust noch stehen?
Ich öffnete die Flasche, reichte sie ihr und sie nahm sie an, trank einen Schluck, nur einen kleinen, dann gab sie die Flasche zurück und ging weiter.
Sie streckte den Rücken und ging zügig voran, das hatte ich noch nie gesehen. Vor vier Monaten war sie zum Sterben zu uns gekommen. Ihre Schultern hatten herab gehangen, jeder Schritt war eine Qual gewesen und schon nach den vier Stufen des Hauseingangs musste sie eine Pause einlegen. Ich erinnerte mich an die Frau, wie sie sich an meinem Arm fest geklammert hatte, mich mit glasigen Augen angesehen hatte. Ich konnte die Wut und Verzweiflung in ihnen sehen. Sie wollte stark sein und im Geiste war sie es auch, aber ihr Körper hatte ihr ihr die Würde versagt, die sie ausstrahlen wollte.
Jetzt musste ich zusehen, dass ich der Frau hinterher kam. Sie ging so schnell voran, dass ich nicht glaubte, das Tempo lange halten zu können. Kurz überlegte ich sogar, ob ich mit dem Auto hinterherfahren sollte, doch so viel Blöße wollte ich mir dann doch nicht geben. Wenn sie das schaffte, dann würde ich ja wohl auch ein paar Meter auf dem heißen trockenen Boden laufen können.
Erst jetzt bemerkte ich, dass auch meine Kleidung an mir klebte. Doch irgendwie schien es eine andere Feuchtigkeit zu sein. Ich schwitzte, ich stank bestimmt auch, doch bei ihr … es wirkte wirklich, als würde sie durch Regen laufen.
»Komm, Frank!«, rief sie mir zu. »Das Meer wartet!«
Das Meer? »Das Meer ist hunderte Kilometer entfernt«, rief ich zurück, doch sie lachte und winkte ab.
»Und es gibt keinen Regen hier«, antwortete sie, »aber es regnet trotzdem.«
Ich seufzte. Ich wünschte, es würde regnen. Ich wünschte es mir in dem Moment wirklich, dass kühle Tropfen den Schweiß von meinem Gesicht waschen würden. Meine Augen brannten bereits.
Sie wartete auf mich und als ich ankam, hielt sie mir ihren Arm hin, wie ich es bei unserer ersten Begegnung getan hatte.
»Das ist nicht nötig«, sagte ich mit einem Lächeln und sie lachte. Anastasia hatte das auch gesagt, hatte aber schnell einsehen müssen, dass sie meinen Arm doch gebraucht hatte.
Ich zuckte mit den Schultern, hakte mich bei ihr ein und da spürte ich es plötzlich: Etwas tropfte auf meinen Kopf.
»Spürst du es jetzt?«, fragte sie in verschwörerischem Ton. Ein weiterer Tropfen, jetzt auf meinem Arm und ich konnte ihn sehen. Es regnete! Es regnete wirklich, doch es ergab keinen Sinn!
Ich schaute auf, keine einzige Wolke in Sicht und doch fielen immer mehr Tropfen auf meinen Körper.
»Wie ist das möglich?«
»Bernhard weist mir den Weg. Es ist soweit.«
Ich schaute sie an und nickte. Ich nickte einfach, als wäre unsere Situation selbstverständlich, dass ein toter Seemann seiner Frau bei klarem Himmel in einer Wüste Regen schenkte.
»Und das Meer?«, fragte ich und räusperte mich.
»Es ist nicht mehr weit. Trink, Frank, sonst fällst du mir noch um.«
Sie lachte, ich nahm einen Schluck aus der Flasche, doch ich fühlte mich gar nicht mehr so durstig wie eben. Der Regen, ich hatte einfach keine andere Bezeichnung, verringerte meinen Bedarf nach Wasser. Er gab mir Kraft und ich war mir sicher, dass er die Quelle für Anastasias wundersame Genesung war. Doch würde sie anhalten? Was würde passieren, wenn wir das Meer erreichten und dann zurückkehrten.
Ich folgte ihr sinnierend eine halbe Stunde, während sie mir die alten Geschichten von Bernhard, ihrem Ehemann, erzählte. Das letzte Mal, als ich die Geschichte gehört hatte, wurde sie mit krächzender Stimme und vielen Atempausen erzählt, jetzt aber plapperte Anastasia ohne Pausen und erinnerte mich sehr an meine sechsjährige Nichte.
Dann blieb sie abrupt stehen und hob einen Zeigefinger. Sie lächelte. »Was?«, fragte ich, doch sie antwortete mit einem Zischen und zeigte auf ihr Ohr. Ich neigte den Kopf zur Seite und tatsächlich. Ich konnte Meeresrauschen hören und plötzlich ließ der Regen nach und das Rauschen der Wellen wurde noch stärker.
»Wir haben es fast geschafft«, sagte Anastasia und lachte freudig. Dann überraschte sie mich erneut, als sie plötzlich rannte und das Bild meiner Nichte war komplett.
Ich folgte ihr. Die Wellen tosten gegen eine unsichtbare Brandung, doch zu sehen war nichts. Erst als Wasser in meine Schuhe lief, als würde ich in einer Pfütze stehen, verstand ich. Das Meer war, wie der Regen, nur dann sichtbar, wenn wir es berührten.
Ich schaute auf den Boden. Die Wellen spülten Schaum um meine Füße und ich glaubte, etwas in dem eigentlich harten Sand einzusinken. Anastasia rief den Namen ihres Ehemanns.
»Bernhard, Berni, mein Liebster, ich bin hier!«
Das Wasser war nur wenige Zentimeter um meine Füße sichtbar, um meine und ihre. Sie zog ihre Schuhe aus, ging weiter auf den Horizont zu, wo ich nun ein Schemen sehen konnte. War das ihr Mann? Winkte er sie zu sich?
»Anastasia, warte!«, rief ich und watete weiter. Schon bald war ich knietief in dem wunderbaren warmen Wasser, sie bereits bis zu den Hüften. Ihr Nachthemd klebte nicht mehr am Körper, es waberte im unsichtbaren Wasser. Es wurde tiefer, immer tiefer. Dann verstand ich endlich und ich wusste, wofür es Zeit war.
»Komm zurück«, rief ich. Ich streckte meinen Arm nach ihr aus, doch sie war zu weit entfernt.
Den Blick mir zugewandt, lächelte sie und sagte: »Danke, dass du für mich da warst. Aber jetzt muss ich gehen. Folge mir nicht, Frank, du hast noch viel Zeit.«
Sie ging einen weiteren Schritt in das Meer, dann drehte sie sich noch einmal um: »Ich habe dir ja gesagt, ich werde mit meinem Bernhard vereint sein.«
Ja, das hatte sie. Ich spürte, wie meine Wangen feucht wurden, ließ die Tränen einfach laufen. Das war das erste Mal seit Jahren, dass ich für eine Patientin weinte.
»Lebe wohl, Anastasia«, rief ich hier hinterher und spürte, dass dies nicht das Ende für sie war.
»Du auch, Frank«, antwortete sie und ging weiter. Der Schemen war in der zwischenzeit auf uns zugekommen. Jetzt konnte ich einen Mann mittleren Alters in Seemannskluft erkennen. Er sah aus wie auf Anastasias Fotos. Dankend nickte er mir zu, dann plötzlich verschwand das Wasser um mich herum und ich sank auf den Boden.
Dank meines mobilen GPS-Systems fand ich den Weg zurück, von Anastasia blieb keine Spur.